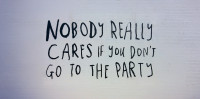Rethinking Marketing
Marketing ist an einem Wendepunkt. Zwischen fragmentierten Kanälen, Effizienzdruck und wachsenden Erwartungen wird es immer schwerer, echten Unterschied zu machen. Umso wichtiger ist ein neues Mindset – eines, das Haltung zeigt, strategisch denkt und mutig handelt. Genau darum geht es in diesem neuen Sammelband "Rethinking Marketing", herausgegeben von Oliver Klein und Wolfgang Merkle, in dem 24 führende Köpfe aus Marketing, Agenturen und Unternehmen - darunter auch unsere Inhaberin und CEO Kim Notz – ihre Perspektiven teilen.

Grenzüberschreitung – eine notwendige Voraussetzung für erfolgreiches Marketing
In diesem Blog-Beitrag geht es um den Beitrag unser Inhaberin und CEO Kim Notz, die als Co-Autorin an dem Buch "Rethinking Marketing" mitgewirkt hat.
Schon per Definition ist das Marketing eine Disziplin der Grenzüberschreitungen. Es ist angesiedelt an der Grenze zwischen Unternehmen und ihren Märkten, die es bearbeitet oder auch erst schafft. Um dies zu tun, muss es permanent Grenzen überschreiten. Werbung tut das, aber Marketing war schon immer mehr als Werbung.
Um seiner Rolle gerecht zu werden, muss das Marketing seine Ketten sprengen und in mehrfacher Hinsicht Grenzen überschreiten. Nicht als ein bloßer Akt der Rebellion, das auch, aber vor allem aus purer Überlebensnotwendigkeit. Nicht allein für das Marketing selbst, sondern für die Unternehmen, die Marketing treiben. Und auch das sind schon per Definition alle Unternehmen.
Die erste Grenzüberschreitung: Raus aus der Reklamefalle
Wenn sich Marketing auf Werbung beschränkt und die anderen drei Ps (Price, Product, Place) vernachlässigt, dann schrumpft es sich selbst. Der CMO wird zum Reklameonkel, dabei muss er eigentlich der zentrale Werttreiber im Unternehmen sein. In marketinggetriebenen Unternehmen ist er das auch, und dort trägt er gelegentlich andere Titel, zum Beispiel CEO.
Die Gründe für den Bedeutungsverlust des Marketings sind vielfältig. Unternehmen haben sich in Silos organisiert, Produktentwicklung und Vertrieb wurden vom Marketing getrennt. Neben strukturelle und organisatorische Veränderungen trat die Digitalisierung als Treiber. Einer ganzen Generation von Marketingleitern, die nun allmählich die Bühne verlässt, fehlte das Verständnis für die digitale Revolution im Marketing. So kam es, dass die digitalen Kompetenzen zunächst anderswo angesiedelt wurden und erst nach und nach in die Marketingabteilungen einwanderten.
In einer späteren Phase erodierte dann, ebenfalls durch die Digitalisierung, auch noch die Markenkompetenz. Der Siegeszug des Performancemarketings brachte zwar eine Wiederannäherung an den Vertrieb, doch ging dies in vielen Fällen zulasten der Brand. Hier schnappte die Messbarkeitsfalle zu. Performance lässt sich im Lower Funnel besser messen als im Upper Funnel, und digitale Kanäle sind hier sowieso im Vorteil. Wurde in früheren Krisenzeiten gern pauschal am Marketing gespart, so trifft es heute eher die Marke.
Was hingegen messbar zum Umsatz beiträgt, ist weniger von Kürzungen bedroht. So endete der CMO als Betreiber eines digitalen Vertriebssystems mit hoher Komplexität und hohen Kosten, aber zweifelhaftem Wertbeitrag. Dieses System mit Hilfe von Agenturen und IT-Dienstleistern am Laufen zu halten, bindet enorme Kapazitäten, doch es differenziert Marken kaum im Wettbewerb. Der CMO, oder was davon übrig ist, sitzt also gleich doppelt in der Falle: Er hat geringen Einfluss auf das Produkt, und die Markenkompetenz ist geschwächt – auch weil Marke und Markenerlebnis heute weniger durch Werbung bestimmt werden als in früheren Zeiten.
Um dieser Falle zu entkommen, muss das Marketing Grenzen überschreiten. Es ist nicht damit getan, Silos aufzubrechen und die Organisation zu verändern. Das Marketing braucht eine neue Strategie. Damit sind wir bei einer zweiten Grenzüberschreitung.
Die zweite Grenzüberschreitung: Die Neuerfindung von Strategie und Beratung
Strategie in Reinform bedeutet Loslassen, Weglassen und einen schmerzhaften Weg zum Wesentlichen. Um wieder handlungsfähig zu werden, muss das Marketing Ballast abwerfen, Komplexität reduzieren und Kosten eliminieren, die nicht zur Wertschöpfung beitragen. Das ist leichter gesagt als getan. Im Marketing herrscht kein Mangel an verrückten Ideen, Kanälen, Berührungspunkten und Kommunikationsanlässen. Knapp sind hingegen unabhängige Richtungsentscheidungen und strategische Verbindlichkeit.
Das schaffen viele Unternehmen nicht selbst, und auch Agenturen sind nicht unbedingt dazu in der Lage. Denn Agenturen haben Leute mit bestimmten Fähigkeiten an Bord, die ausgelastet werden müssen. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel. Auf der Unternehmensseite sind die vorhandenen Mittel stets limitiert, ebenso wie die internen Kapazitäten im Marketing. Aus der nie zuvor gekannten Vielzahl der Möglichkeiten und angesichts ambitionierter Ziele bei begrenzten Mitteln ergibt sich ein Beratungsbedarf.
In diese Lücke stoßen seit Jahren zahlreiche neue Spieler. Die Technologisierung des Marketings hat IT-Häuser auf den Plan gerufen, die sich bis dato wenig mit Marketing beschäftigt hatten. Der Beratungsbedarf hat Beratungshäuser auf das Spielfeld gelockt, die Marketing eher aus der Perspektive der Organisationsentwicklung betrachten. Auch Agenturen kämpfen um ihr Stück dieses Kuchens und bauen ihre Beratungskapazitäten aus. Es geht um nichts weniger als die Neuerfindung von Strategie und Beratung.
Mit einer gewissen Seniorität und dem Mandat zur Grenzüberschreitung entwickeln die neuen Strategen und Berater einen holistischen Blick auf das Marketing. Strategie heißt Missionen zu definieren, bei denen es um Risiko, Unsicherheit und kritische Businessentscheidungen geht. Ein klarer Fokus kann eine radikale Befreiung sein. Der Weg dorthin ist schmerzhaft, weil er all die Dinge aufzeigt, die Marketing nicht mehr machen kann und auch nicht mehr machen sollte. Daran hängen Egos, Emotionen, Verlustängste und Nostalgie.
Aber wenn das Marketing sich nicht häutet, wird es verwechselbar. Genau das ist passiert, auf Unternehmensseite wie auf Agenturseite. Spiegelbildlich zum Marketing sitzen auch Agenturen in einer strategischen Falle. Und genau wie das Marketing müssen auch Agenturen (wieder) Grenzen überschreiten.
Die dritte Grenzüberschreitung: Raus aus der Commodity-Falle
Es nutzt dem Marketing wenig, Agenturleistungen als austauschbare Vorprodukte zu behandeln und vor allem über den Preis einzukaufen. Marketing muss Marken und Produkte differenzieren, und dazu braucht es in der Regel Agenturen, die radikal und strategisch sind, aber gerade nicht austauschbar.
Es gab eine Zeit, aber vielleicht ist das auch nur ein Mythos, zu der Agenturen die Rebellen anzogen. Die Überzeugungstäter, die Grenzen überschritten und Widerstände ausgehalten haben, die sich nicht an Regeln und Prozesse gehalten haben. Davon ist wenig geblieben. Agenturen sind zu kleinen Corporates geworden, die sich in Pitches mit ihren Prozessen und Methoden präsentieren. Sie sind ihren Kunden zu ähnlich geworden und dadurch in die Commodity-Falle getappt.
Aus Marketingsicht liegt die Daseinsberechtigung von Agenturen aber darin, ein starkes Verständnis von Kulturen, von Zeitgeist, von gesellschaftlichen Veränderungen zu haben. Also Dinge zu sehen, die resonieren und sie für Marken zu übersetzen, oder umgekehrt Marken in diese Kulturen und in diese gesellschaftlichen Strömungen und den Zeitgeist zu übersetzen. Stattdessen betreiben sie Stakeholdermanagement, verwalten Prozesse und füllen Exceltabellen aus. Es scheint, als ob Kontrolle ihre Antwort auf die hochgradige Komplexität ist.
Das widerspricht zutiefst dem kreativen Kern ihrer Aufgabe. Die Falle, in der Agenturen sitzen, ist ihr überkommenes, seit Jahrzehnten unverändertes Geschäftsmodell. Wer gegenüber seinen Kunden auf Basis von Tagessätzen abrechnet, hat ein fundamentales Problem: Er muss die tatsächlich geleisteten Aufwände stundengenau transparent machen, völlig unabhängig von der realisierten Wertschöpfung. Der geschaffene Mehrwert landet überwiegend beim Unternehmen, das die Tagessätze stets zu drücken bemüht ist. Wer als Agentur keine hohen oder wenigstens auskömmlichen Tagessätze durchsetzen kann, verliert dieses Spiel.
Das Marketing braucht Agenturen, um auf kreative Weise Probleme zu lösen, die es selbst nicht lösen kann. Die dafür geleistete Arbeitszeit taugt nur bedingt als Indikator für den geschaffenen Wert. Das Geschäftsmodell sollte die Wertschöpfung reflektieren und keine Anreize dafür setzen, den Aufwand und die Tagessätze zu maximieren. Dies liegt auch im Interesse der werbungtreibenden Unternehmen. Sie wollen Lösungen kaufen und nicht Arbeitszeit. Agenturen können Wachstum und Wertschöpfung verkaufen und so der Commodity-Falle entkommen. Dies gibt allen Beteiligten die Chance, die Dinge wesentlich effizienter zu gestalten. Der Weg dahin ist allerdings schmerzhaft – siehe oben.
Die vierte Grenzüberschreitung: Zurück zur Popkultur
Das Marketing muss (wieder) die Grenze zur Popkultur überschreiten. Seit dem Internet nimmt die Anzahl, Größe und Bedeutung von Subkulturen kontinuierlich zu. Als Gegengewicht zur vielfach beklagten Zersplitterung der Marketingkanäle wirken dann die popkulturellen Phänomene, die aus der Nische stammen und in den Mainstream hinein wirken. Pop kommt von populär, und eine gewisse Popularität, zumindest in der Zielgruppe, ist ja ein Ziel der Werbung, wenn nicht das Wichtigste.
Die Aufgabe für Werber liegt darin, die Grenzen zwischen Werbung, Popkultur und unterschiedlichen Genres verschwimmen zu lassen. Werbung muss wieder Spaß machen und etwas sein, was die Leute gerne sehen wollen und uns aus den Händen reißen, weil es Teil der Popkultur ist. Dazu braucht es einen Cultural Fit zwischen Marke und (Sub-)Kultur. Es ist ein Geben und Nehmen. Marken müssen sich und die jeweilige Subkultur fragen, was diese braucht und was sie ihr geben können. Was könnte gut ankommen, was nicht so gut?
Erst aus diesem Dialog können dann, gemeinsam mit Vertretern der Subkultur, Kampagnenideen entstehen, die Resonanz erzeugen. Im Idealfall wird die Kampagne auch mit Künstlern, Fotografen und Regisseuren aus der jeweiligen Szene realisiert. Dieser Ansatz steht im Licht der Glaubwürdigkeit, in diesem Kontext gern Credibility genannt. Es ist ein Abschied von der alten Logik, die zuerst die Marke und das Produkt sieht und von dort aus in Richtung Zielgruppe denkt.
Cultural Marketing beginnt mit der Suche nach dem Cultural Fit und dem Dialog mit der Subkultur. Es verändert das Selbstverständnis von Marketing (Stichwort Demut) und steht auch Agenturen gut zu Gesicht, die sich nicht als dezidierte Cultural-Marketing-Agenturen verstehen.
Die fünfte Grenzüberschreitung: Der paradoxe Konsument in der Experience Economy
Konsumenten und ihre Wünsche sind nicht frei von Widersprüchen, denn Menschen sind mehr als bloße Verbraucher von Industrieprodukten. Sie sind Teil verschiedener Kulturen und Communities. Die Verbraucher sind heute durchdigitalisiert wie nie zuvor und sehnen sich gleichzeitig nach guten Erlebnissen in der analogen Welt. Ein Paradox, oder zwei Seiten der gleichen Medaille? Je stärker Produkte und Services austauschbar werden, desto mehr tritt das Erlebnis in den Vordergrund. Nur ein Premium-Erlebnis rechtfertigt dann einen Premium-Preis.
Erlebnisse haben heute so gut wie immer beide Komponenten, digital wie analog. Die Verbraucher haben online wie offline die gleichen Erwartungen an ihre Markenerlebnisse. Die Kunst ist, beides so zusammenzubringen, dass die paradoxen Konsumenten in ihrer Customer Journey ein durchgängiges Markenerlebnis bekommen. Die Kultur, oder sagen wir besser: die Kulturen sind immer schon da, bevor eine Marke auf den Plan tritt. Kulturen und Subkulturen manifestieren sich in Communities, und Marken können im besten Fall etwas dazu beitragen: eine Kultur oder eine Community bereichern.
Diese Sichtweise stellt die verbreitete Annahme auf den Kopf, derzufolge Marken ihre eigenen Communities hätten. Das mag in manchen Fällen so sein, aber selbst eine Premiummarke wie Porsche betreibt die wenigsten Porsche-Clubs selbst. Es sind vielmehr die Menschen, die von Porsche als Marke und den Produkten fasziniert sind. Communities organisieren sich selbst.
Das Marketing hingegen nutzt den Begriff Community heute dermaßen inflationär, dass mittlerweile schon Facebook-Fans, Newsletter-Abonnenten oder Kundenkarteninhaber als Teil einer Community gelten. „Community“ ist eine der zentralen Marketing-Bullshit-Vokabeln der letzten Jahre. Die wenigsten Marken werden es schaffen, zum Kern einer eigenen Community zu werden. Vielmehr geht es um Community Matching: Wo sind bereits starke Communities, in die sich eine Marke einbringen kann?
Die Customer Journey ist heute unausweichlich ein analog-digitaler Hybrid, in so gut wie allen Fällen. Doch welche Marke hat schon sämtliche Touchpoints so im Griff, dass ein konsistentes Markenerlebnis entsteht? Eine verbreitete Schwäche, die übrigens Onliner wie Offliner teilen, ist der übermäßige Fokus auf die Transaktion. So wird Performancemarketing häufig überstrapaziert und bis zum letzten Prozentpunkt ausoptimiert, zulasten von Marke und Erlebnis. Auch im stationären Handel tritt die Inszenierung oft zugunsten des Abverkaufs zurück.
Der stationäre Handel muss seine Fixierung auf die Transaktion aufgeben und sich auf das Paradigma der Experience Economy einstellen. Die Menschen kommen weiterhin in die Innenstädte, nicht zwingend, um etwas zu kaufen, sondern um dort etwas zu erleben. Die paradoxen, durchdigitalisierten Konsumenten brauchen physische Orte, um Marken und Produkte (und andere Menschen – Stichwort Communities) erleben zu können.
Grenzen zu überwinden bedeutet also, ein Ökosystem zu schaffen, in dem das Digitale und das Physische nicht nur koexistieren, sondern sich gegenseitig bereichern und verstärken. Ein solches Marketing setzt auf die Kraft des Erlebnisses und knüpft eine dauerhafte Verbindung, die Marke und Konsument in einer ständig sich weiterentwickelnden, gemeinsamen Erzählung zusammenführt. So wird der physische Kaufakt zu einer Etappe in einer längeren Reise der Markeninteraktion, die weit über den Kauf auch nach Verlassen des Stores fortbesteht.
Die sechste Grenzüberschreitung: Die Wiedervereinigung von Kreation und Media
Das Marketing steht heute durch die steigende Komplexität, die fortschreitende Fragmentierung der Kanäle und Zielgruppen, die wachsende Bedeutung von Technologie und das zunehmende Tempo unter Druck. All das spiegelt sich in der Agenturlandschaft wider und stellt Marketingverantwortliche vor die Frage nach dem richtigen Agentursetup. Früher hieß die Frage: Wer ist die Leadagentur? Und die Antwort war gern: eine Kreativagentur. Kreativität ist heute immer noch wichtig, gehört aber in den richtigen Kontext. Das heißt datengetriebenes Marketing. Wer die Martech-Systeme und damit die Daten kontrolliert, ist hier im Vorteil.
Das gibt Mediaagenturen eine Schlüsselrolle. Sie sitzen auf einem Datenschatz, der den werbungtreibenden Unternehmen gehören würde – wenn sie denn die Fähigkeiten besäßen, den Schatz zu heben. Agenturen und Berater können dabei helfen und so eine zahlenbasierte Grundlage für das Marketing schaffen. Auf dieser Basis können dann alle Beteiligten arbeiten. Neben klassischer Soziodemografie spielen Behavioural Targeting und Mindset-basiertes Targeting heute mit im Media-Konzert. Der Weg über das Mindset eröffnet dann wieder neue Möglichkeiten der Personalisierung, gerade in Kombination mit KI-gestützten Produktionsmöglichkeiten.
Spätestens an diesem Punkt ist die Zusammenarbeit mit Kreativagenturen ein Thema, und es stellt sich die Frage nach dem Modus Operandi. Letztlich ist das Ziel, das Marketing deutlich steuerbarer und prozessorientierter zu machen, über die gesamte Journey von Aktivierung bis zu Messung und Reporting. Dazu kommt, dass Retail und Marketing durch Commerce, D2C und Retail Media stärker zusammenwachsen. Und es geht darum, Paid und Earned Media besser zu orchestrieren und aus der Customer Journey heraus zu denken, um ein besseres und relevanteres Kommunikationserlebnis zu schaffen.
Das kann auch bedeuten, Paid-Maßnahmen zu verringern, zugunsten von Owned Media mit dem richtigen Content und den richtigen Touchpoints. Das Gesamtsystem kann so deutlich effizienter arbeiten als es Paid Media allein könnte. Vorausgesetzt, dass der Einfluss der unterschiedlichen Touchpoints und die Zusammenhänge auch messbar sind.
Angesichts der zunehmenden Fragmentierung bleibt keine andere Wahl als eine enge Zusammenarbeit von Kreation, Content und Media, unterfüttert mit Daten und Technologie, um für den Konsumenten eine effektive und effiziente Kontaktstrecke zu gestalten. Es sind Ökosysteme aus Marketing, Agenturen, Medienkanälen, Technologie und Konsumenten, die wir zu gestalten und zu entwickeln haben. Solche Ökosysteme entstehen nicht über Nacht, und es braucht bei allem Tempo eine mittel- und langfristige Perspektive.
Das Ganze ist ein System und ein Prozess, Stichwort Langfristigkeit, der mit jeder Iteration besser wird und allen Beteiligten, Unternehmen wie Agenturen, den Vorteil aufzeigt: dass bessere Kampagnen mit besseren Ergebnissen alle am Tisch besser dastehen lassen. Denn letztlich treten wir alle mit dem Versprechen an, die Unternehmen bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Und da hilft es, ein solches System zu haben, das die hergebrachten Grenzen überschreitet, zwischen Unternehmen und Agenturen, zwischen Kreation und Media.
Die siebte Grenzüberschreitung: Das Narrativ als Strategie
Gegen die atemlose Kurzfristigkeit und die dauernde Angst, etwas zu verpassen, hilft nur ein langfristig tragfähiges Fundament. Marken brauchen eine Basis, die nicht durch jeden neuen Kanal und jede neue Technologie erschüttert werden kann. Dies zu schaffen ist die vornehmste Aufgabe der Strategie. Um dies zu schaffen, braucht es eine weitere Grenzüberschreitung: Die Strategie manifestiert sich in einem Narrativ, und das Narrativ wird zur Strategie. Wenn das Narrativ selbst als Strategie verstanden wird, trifft das Unternehmen strategische Entscheidungen nicht mehr allein von der Excel-Tabelle aus, sondern aus dem Narrativ heraus.
Hier schließt sich dann der Kreis zum Markt, wenn Sinnstiftung nicht nur in die Organisation hinein stattfindet, sondern auch nach außen. Menschen finden das Narrativ spannend und erzählen es weiter, Medien greifen es auf. Es funktioniert für das Business nach innen und ist medial anschlussfähig. Dahinter steckt eine anthropologische Einsicht: Menschen brauchen Erzählungen, um sich in der Welt zurechtzufinden.
Menschen sind, so haben es Samira El Ouassil und Friedemann Karig in ihrem gleichnamigen Buch beschrieben, „erzählende Affen“. Unser Gehirn ist so strukturiert, dass Narrative anschlussfähig sind. Auf dem Weg über Erzählungen geben wir überlebensnotwendige Erfahrungen und Erlebnisse weiter. Deshalb sind Narrative notwendigerweise nicht statisch, sondern entwickeln sich weiter. Es ist aber eher ein Fortschreiben, weil neue Erkenntnisse und Erfahrungen dazukommen.
Narrative antworten auf die Sehnsucht nach langfristiger strategischer Markenführung, indem sie eine Dramaturgie aufbauen. Neben den Protagonisten haben darin auch die Antagonisten ihren Platz. Wo besteht ein Mangel, und wo sind die Gegenkräfte, die uns daran hindern, diesem Mangel abzuhelfen? Hier kann eine Kommunikationsplanung aufsetzen, die dann wieder Kampagnen steuern kann. Die Erzählung bekommt Tiefe und eine zeitliche Struktur.
Das Wichtigste, was unsere Branche leistet, ist Differenzierung. Vielleicht braucht die Agenturbranche selbst ein neues Narrativ – eine neue Antwort auf die Frage, was wir für die Gesellschaft leisten und wie wir in der Sinnökonomie anschlussfähig bleiben. Dazu gehört, dass wir uns nicht auf die Kreativseite beschränken, sondern uns stärker mit dem Business auseinandersetzen. Dass wir Marketing nicht länger losgelöst von anderen Bereichen wie zum Beispiel Produkt- und Serviceentwicklung betrachten.
Die Aufgabe der Agenturen ist es, Antworten zu liefern. Narrative antworten auf die Fragen der Zeit.